neuland -- Die Schweiz und der Nahe Osten
Hier ein paar Gedanken, publiziert von den Kollegen von neuland, einem neuen gesellschaftspolitischen Portal:

Hoffnung ist keine Strategie
Der Nahe Osten – das Eldorado der Polit-Heuchler und Betroffenheits- Beseelten. André Marty, bis im Sommer 2010 Nahost-Korrespondent des Schweizer Fernsehens SF, plädiert für eine neue Ehrlichkeit im Umgang mit dem israelisch-arabischen Konflikt.
„Unausgewogen“ sei die Reise von Verteidigungsminister Ueli Maurer nach Israel, titelte die Neue Zürcher Zeitung NZZ, und giftelte: „Von einem neutralen Land, das als Hüter der Genfer Konventionen bekannt ist, darf man mehr Feingefühl erwarten.“
Und vor dem Bundeshaus versammelte sich ein Demonstranten- Grüppli von rund 100 Engagierten, die darauf bestanden, dass bundesrätliche Israel-Reisli stehe im Widerspruch zum Schweizer Engagement für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. „Mehr Feingefühl“, „gerechter Frieden“ - so redlich diese Positionen sind, so wenig aufrichtig und konsequent ist unser Verhalten mit Blick auf den Nahen Osten.
Zwar sind praktisch durchwegs ausgewiesene und – was keine Selbstverständlichkeit ist – engagierte EDA- Diplomaten vor Ort im Einsatz. Wenn etwa der Schweizer Botschafter in Tel Aviv, Walter Haffner, während des israelischen Gaza- Krieges sich persönlich an einem Checkpoint für den Zugang von Hilfsgütern zum Kriegsgebiet einsetzt, geht das weit über das übliche Mass an persönlichem Einsatz hinaus.
Wenn die in Amman stationierte Schweizer Botschafterin Andrea Reichlin Bundespräsidentin Doris Leuthard nach Jordanien – einem Zwerg auf der Weltwirtschaftsmappe, aber Scharnier-Staat im Nahost – Konflikt - zum Abschluss von wirtschaftlichen Zusammenarbeitsabkommen lockt, dann ist dies ein bemerkenswerter Coup. König Abdallah II. und sein nicht minder strahlender Schweizer Gast debattieren über das Schweizer Engagement in der Region - das wäre eigentlich mehr wert gewesen als ein paar Nice-to-have-Bilder. Wäre.
Ehrlich wäre es gewesen, im gleichen Atemzug anzufügen, was die Schweizer Bundespräsidentin nach ihrem festlichen Dinner im Königspalast zu Amman tat: Sie reiste nach St.Gallen, um die Olma zu eröffnen. Darin wird ein Dilemma der Schweizer Politik ersichtlich: Nahost- Friedensgespräche (Amman) und Milchmarkt (St.Gallen) – das kann nicht gut gehen.
Direkt und ungeschminkt gefragt: Lässt sich an den Reisen der Volkswirtschafts-Ministerin und des Verteidigungs-Ministers eine konsequente Nahost- Aussen- oder zumindest Wirtschaftspolitik – die Implementierung der Politik der guten Dienste und aktiven Neutralität – der Schweiz festmachen? Oder hat die Schweizer Reise-Diplomatie nicht viel eher etwas beschränkt Koordiniertes, gar Ad-hoc-mässiges? Die Stichworte dazu: Iran-Reise der Aussenministerin, Libyen-Besuche des Finanzministers und der Aussenministerin, Erläuterungen hier und dort, was es mit der direkten Demokratie im Zusammenhang mit der Minarett- Initiative auf sich hat. Beispiele, die zeigen, dass sich die Schweiz eher mit Consequence Management statt mit Risk Management befasst.
Die offizielle Schweiz hat keine den Mittelmeer-Raum betreffende aussenpolitische Strategie, die diesen Namen verdiente. Nahost-Sonderbotschafter kommen und gehen – in den letzten sechs Jahren gleich drei. Die Schweizer Botschaften im Mittelmeer-Raum werden auf Schmalspur gefahren; in der Regel zwei Diplomaten und einige konsularische Beamte. Das EDA-Nahost-Desk in der Zentrale war in den letzten beiden Jahren praktisch ausschliesslich mit der Libyen-Krise absorbiert. Die geografischen Zuständigkeiten der vom VBS in die Region entsandten immerhin vier Verteidigungs-Attachés (VA) wurden vor kurzem neu definiert. Doch der für Beobachtung des zentralen Players Israel verantwortliche VA sitzt irritierender weise nach wie vor nicht in Tel Aviv, sondern in Rom. Und für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA stellt der Nahe Osten keine Schwerpunkt-Region dar.
Rund um die Vernehmlassung zum „Sicherheitspolitischen Bericht 2010“ wurde denn auch wiederholt Koordinierungsbedarf zwischen den verschiedenen offiziellen Stellen deutlich. Gleichzeitig unterstreicht der Blick in den Nahen Osten aber auch, wie komplex heutige Realitäten geworden sind – wie sehr Aussen- oder eben Sicherheitspolitik - durch innenpolitische Machbarkeiten gesteuert wird.
Zudem wirkt das Oslo-Trauma bis heute in den Gängen des EDA nach; das Trauma zusehen zu müssen, wie ein anderer neutraler Staat im Nahost- Konflikt kurzfristig Lorbeeren einheimste: Norwegen leierte den Oslo-Friedensprozess an, mehrjährige, vorerst geheime Verhandlungen, die in den 90er Jahren in der Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung (Oslo I) und dem Abkommen über die Autonomie des Westjordanlandes und Gaza- Streifens (Oslo II) zwischen Israel und den palästinensischen Vertretern mündeten. Ziel war ein Friedensabkommen, sprich die Errichtung eines überlebensfähigen palästinensischen Staates Seite an Seite mit einem in Sicherheit lebenden Israel. Geworden daraus ist nichts, geblieben ist die Desillusion.
“The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity,” wird Israels Aussenminister Abba Ebans Ausspruch nach der Genfer Friedenskonferenz vom Dezember 1973 gern und häufig zitiert. Eban, ein brillanter Rhetoriker, gewiss; bloss, dass Ebans Zitat nicht zwingend die einzige Wahrheit im Nahen Osten wiedergibt.
Ein Beispiel aus der Reihe der verpassten Möglichkeiten möge genügen: Die Arabische Friedensinitiative. Dieser (saudi-)arabische Vorstoss sieht, vereinfacht gesagt, Israels kollektive Anerkennung durch die arabische Welt vor, wenn sich Israel sich im Gegenzug aus den 1967 völkerrechtswidrig besetzten Gebieten zurück zieht – ein 2002 eingebrachter und 2007 erneuerter Vorschlag. Nüchtern betrachtet ist das the only show in town, die einzige Alternative zum ermüdenden Konfliktmanagement mit ungewissem Ausgang. Und vor allem war diese Initiative eine bemerkenswerte Kehrtwende der arabischen Leader nach der bisherigen Politik der drei Nein: Keinen Frieden, keine Anerkennung, keine Verhandlungen mit Israel.
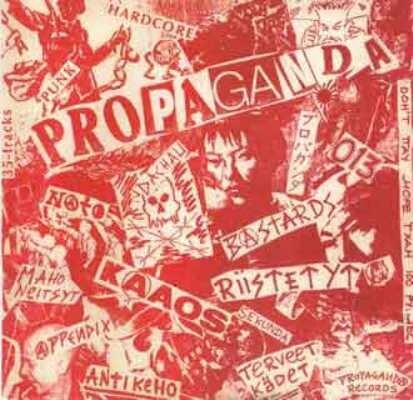
Und Israel? Das offizielle Israel hat die arabische Initiative bis heute weitgehend totgeschwiegen. Einzig Benjamin Netanyahu, heute Israels Premierminister, lehnte 2007 die arabische Initiative rundweg ab. Der Rückzug Israels aus dem Gaza – Streifen habe gezeigt, dass “any Israeli withdrawal – particularly a unilateral one – does not advance peace, but rather establishes a terror base for radical Islam”.
Selbstkritisch räumt der einstige jordanische Aussenminister Marwan Muasher freilich ein, dass auch die arabische Welt die Initiative sträflich vernachlässigt habe: “It did not really follow up on it with a major promotional campaign to explain what it really means to the Israeli public and to the international community as well.”
Simulieren und Jammern
Wer Nahost- Konflikt sagt, meint primär einmal einen Konflikt voller Versäumnisse und vertaner Möglichkeiten beider Konfliktparteien – und sehr viel Selbstmitleid. Beide Konfliktparteien haben es zu meisterlichen Qualitäten im Blame-Game gebracht; gegenseitige Schuldzuweisungen sind im Nahen Osten sehr viel schneller zu haben als politische Visionen oder gar praktikable Kompromiss-Vorschläge.
Die israelische Aktivistin Tanya Reinhart spricht denn auch von einer Strategie des auf Zeit Spielens: „It’s sufficient to declare intentions, and start a new process of negotiations, the complex art of the simulation of peace“.
Seit der israelischen Staatsgründung vor 62 Jahren, und nach bald 20 Verhandlungs- Jahren gibt es weder klare geografische, politische, noch gesellschaftlich stabile Verhältnisse, noch hätte sich die Sicherheitslage Israels oder der Lebensstandard der Palästinenser verbessert.
Eine der Ursachen dafür dürfte in der israelischen Verhandlungsstrategie zu suchen sein: Verhandlungen werden durch Sicherheitsüberlegungen geprägt – und nicht durch politische Lösungsansätze.
Israels Aussen- und Innenpolitik ist eigentlich reine Sicherheitspolitik: es gibt lediglich eine Sicherheits- Kommission im Parlament, die sowohl für sicherheits- als auch aussenpolitische Fragen zuständig ist. Die israelische Politikwissenschaft prägte deshalb den Begriff der Security-Subkultur.
Eine Erklärung dafür mag sein, dass in Israel viele hochrangige Militärs früher oder später in die Politik einsteigen – dieselben Leute, die militärische Lösungen mit einer militärischen Logik angingen, sollen sich dann an „Friedensverhandlungen“ beteiligen. Wer kann es den Sterne-Generälen verübeln, dass sie diese Verhandlungen mit denselben Denkmustern angehen wie ihre frühere Tätigkeit. Israel sucht darum bis heute nach militärischen Lösungen für politische Probleme.
Im Gegenzug ist es auch vielen palästinensischen Verantwortlichen nie gelungen, den Schritt vom Kalaschnikov-schwingenden Militanten zum gewieften Politiker mit Weitblick zu vollziehen. State and capacity building sind weitgehend gescheitert. Die palästinensische Autonomiebehörde versagte bezüglich des Friedensprozesses, der Basis-Versorgung mit Arbeit, Strom, Nahrungsmitteln, Erziehung, Gesundheitswesen und Sicherheit. Häufig berechtigte, aber strafrechtlich praktisch nie aufbereitete Korruptionsvorwürfe pflastern den palästinensischen Weg in die Sackgasse ebenso wie Menschenrechts-Verletzungen durch die eigenen Sicherheitsdienste; Folter gehört zum schwer verdaulichen palästinensischen Alltag. Die einst säkulare Gesellschaft ist heute tief gespalten und geprägt durch das weitgehende Fehlen von Selbstverantwortung; entstanden ist eine eigentliche „Jammer-Kultur“, die bei westlichen Geber-Ländern auf offene Ohren stösst.
Beide Konfliktparteien appellieren kontinuierlich direkt oder unterschwellig an das schlechte Gewissen westlicher, im 2. Weltkrieg involvierter Staaten. Wenig erstaunlich diktieren denn auch häufig Emotionen das westliche Handeln - respektive Nicht-Handeln - im Nahen Osten.
Bevor Israels Premier Netanyahu und Palästinenser- Präsident Abbas dem Druck aus den USA „nachgegeben“, und sich vor laufenden TV-Kameras erneut an den Verhandlungstisch gesetzt haben, zeigen sich somit fundamental unterschiedliche Ausgangslagen. Die Palästinenser bestehen auf Final status-Verhandlungen, also quasi eine „Alles oder nichts“-Strategie, wohl wissend, dass die andere Seite darauf nicht einsteigen wird. Die Israeli ihrerseits verlangen die Erfüllung von Vor-Bedingungen, sprich die Anerkennung Israels als einem jüdischen Staat, ebenso wohl wissend, dass diese rhetorische Zusage niemals von allen Palästinensern zu haben sein wird. Während Israel also den Status Quo zu halten versucht, stellt ebendieser Status Quo für die palästinensische Seite eine weitere Niederlage dar.
Abgesehen von fundamental unterschiedlichen Verhaltens- und Verhandlungsmustern, dürfte zudem entscheidend sein: Keiner traut dem anderen auch nur ansatzweise über den Weg, billigt dem anderen hehre Motive zu. Und das, nüchtern betrachtet, völlig zu Recht. Der Zynismus der politischen Klasse im Nahen Osten ist schwerlich zu übertreffen.
Der Spielraum für den Westen ist also denkbar gering. Dennoch huldigt der Westen – und damit auch die offizielle Schweiz - seit Jahrzehnten mit an schiere Verzweiflung grenzende Inbrunst einer Art „Religion Nahostfrieden“. Und verdrängt dabei konsequent, dass Hoffnung keine Strategie darstellt.
Friede könne es nur geben durch die Errichtung eines überlebensfähigen palästinensischen Staates. Eine Alternative zur sogenannten Zweistaaten-Lösung gebe es nicht, wird allenthalben gewarnt. Was aber, wenn uns die Realität eines anderen belehrt? Was, wenn das dogmatisch zelebrierte Festhalten an dieser angeblich einzigen Option wesentlich zum direkten Marsch in die Sackgasse beigetragen hat?
Friedensförderung, also zumindest das Neben- wenn schon nicht das Miteinander der Konfliktparteien, sähe anders aus als das krampfhafte Festhalten an einem Konfliktmanagement ohne Perspektive. Friedensbemühungen, das wäre mehr als im Drei-Jahresrhythmus wiederkehrende Verhandlungsrunden, deren Ausgang noch vor dem Auftakt der Gespräche absehbar ist. Wäre.
Frieden wird definiert als die Abwesenheit von Gewalt oder Krieg zwischen und innerhalb von Nationalsaaten, Religionen und Bevölkerungsgruppen. Der Begriff beinhaltet aber auch das Fehlen kultureller und struktureller Gewalt. Die Realität innerhalb Israels, der Alltag im besetzten Westjordanland und im de facto abgesperrten Gaza-Streifen sieht anders aus, grundlegend anders.

Der israelisch-palästinensische Konflikt definiert sich geradezu durch seine Asymmetrie: Das Ungleichgewicht zwischen dominierendem Besatzer und systematisch unterdrücktem Besetztem ist die Grundlage der israelischen Besatzungspolitik. Die besetzten und de facto kontrollierten Gebiete wurden mit einer Kontroll- und Sicherheitsmatrix überzogen, die eine komplette Waren- und Personenkontrolle garantiert. Politische, wirtschaftliche, sicherheitsbezogene, kulturelle und ideologische Kontrollmechanismen sind massgebende und bewusst eingesetzte Mittel einer Besatzungsmacht – es kann keine freie Entwicklung der palästinensischen Gesellschaft unter Besatzung geben. Das sagt nicht irgend eine Pressure-Group, das hält die Weltbank in unzähligen Berichten fest – ohne dass der Westen bereit wäre, davon Kenntnis zu nehmen.
Eine echte Annäherung der Konfliktparteien ist nicht in Sicht. Vielmehr dürften die einseitige Ausrufung eines palästinensischen Staates und damit einhergehend die voranschreitende Isolation Israels die nächste Etappe des Konflikts prägen. Und die Schweiz: wird die Eidgenossenschaft einen Staat Palästina anerkennen?
Im Unterschied zum Kosovo, den die Schweiz als einer der ersten Staaten anerkannte, sehen die ökonomischen Überlebenschancen eines unilateral deklarierten Staates Palästina aufgrund der zu erwartenden massiven EU-Unterstützung geradezu bombastisch aus. Wird sich die Schweiz dann nahtlos in die EU-Strategie einreihen und das neue Gebilde Palästina ohne grosse Diskussion anerkennen? Eine neue Form des autonomen Nachvollzugs sozusagen?
Wir ahnen es: Auch dieser grundlegende Entscheid dürfte ad hoc gefällt werden.
Eine Neudefinition der Schweizer Nahost-Politik ist angesagt. Das mag schmerzhaft werden – ist aber umso notwendiger.
Schmerzhaft, weil dies unweigerlich zur Erkenntnis führen würde, dass die offizielle Schweiz als Player im Nahen Osten von relativer Bedeutungslosigkeit ist. Notwendig, um sich vom Prinzip Hoffnung als einziger Strategie zu verabschieden. Eine ausformulierte Strategie ermöglichte im Gegenzug aber auch, die limitierten Mittel und Kapazitäten kohärenter einsetzen zu können. Die Schweiz verfügt über grosses Expertenwissen im Bereich von Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR), in Konflikt-Mediation, der humanitären Hilfe ebenso wie in der Verbreitung über das humanitäre Völkerrecht.
Eine neue Ehrlichkeit ist angesagt – und wenn es nur darum ginge, die eigene Desillusion etwas abzufedern.

Die Menschenrechts-Organisatio n Huma [...]