Von der Angst, den Fremden und uns
Immer häufiger sprechen wir über Dasselbe, meinen aber völlig Unterschiedliches. Wir - in der Schweiz - stimmen ab, und sind verstimmt, wenn's Unverständnis hagelt. Angst? Denkbar. Wut? Sicher.
Ein bisschen Lektüre, um zu verstehen. Verstehen, woraus Kapital geschlagen wird, in Politik und Wirtschaft. Verstehen, wie Angst bewusst und gezielt geschürt wird; verstehen, weshalb Angst viel mit unserem Verhalten zu tun hat.

Alice Schwarzer, die einstige Kämpferin für die Dinge der Frau, und Ulrich Schlüer, der Schweizer Kämpfer gegen das Fremde, haben einiges gemeinsam: Sie lieben keine sanften Töne, dagegen die schwarz/weisse Darstellung der Dinge. Gemeinsam fürchten sie sich auch vor "dem Islam" - oder dem, was sie und die meisten Kritiker darunter verstehen. Wie der Islamwissenschafter und Politologe Thorsten Gerald Schneiders aufzeigt, steht es um den Kenntnisstand der Islam- Kritiker nicht zum besten: Keine arabisch-Kenntnisse, keine theologische oder islamwissenschaftliche Ausbildung.
"Islam- feindlichkeit" zeigt, wie Medien und Politik teils aus puren Ressentiments ein Stellvertreter -Phantom attackieren. Wer als Laie und Interessierter wissen will, wie Populisten dem Flötler von Hammeln gleich Unbekanntes, Unwissen und teils berechtigtes Unbehaben missbrauchen, der wird nach der Lektüre der verständlichen Beiträge aus politologischer, psychologischer, linguistischer, historischer und rechtswissenschaftlicher Sicht einiges verstanden haben. Der Sammelband mit 28 Beiträgen stellt dem die teils ablehnende Haltung muslimischer Menschen gegenüber, die mit Kritik ebenso wenig umzugehen wissen.
Islamfeindlichkeit - wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen; Schneiders, Thorsten Gerald; VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009

"Ignoranz und Intolleranz gehen Hand in Hand." Dominique Moisi ist kein Theoretiker, wenngleich sein akademischer Hintergrund auch an diesen Fähigkeiten keinerlei Zweifel aufkommen lässt. Erinnerung und Ressentiment verhindern Fortschritt und Oeffnung, sagt der französische Denker. Mit Emotionen - Moisi spricht von "richtigen" und "falschen Emotionen" - könne also sehr viel politisches Handeln erklärt werden, nicht nur, aber auch im israelisch - palästinensischen Konflikt, nicht nur, aber auch im Verhältnis zwischen Orient und Okzident.
Während das 20.Jahrhundert als das "Jahrhundert der Ideologien" bezeichnet werden kann, spricht Moisi vom 21.Jahrundert als einer Zeit der Identität: Gefühle wie Angst, Hoffnung und Demütigung sind die Begriffe, anhand derer Mosi unser Re-agieren auf Entwicklungen erklärt. Gespickt mit Beispielen aus der Realpolitik lässt das Buch Politik-Interessierte mit einem ziemlichen Klos im Hals zurück: Wenn Demokratien das Vertrauen in demokratische Modelle verlieren, gleichzeitig aber autokratische Regimes ob ihres ökonomischen Siegeszuges und politischer Stabilität oben aus schwingen, dann leidet der Westen unter dieser Evolution. -- Ein Satz, den Moisi lange vor der eidgenössischen Abstimmung über ein verfassungsmässig zu verankerndes Verbot von Minaretten geschrieben hat.
The Geo Politics Of Emotion; Moisi, Dominique; Bodley Head, 2009

Wir sind die gesundeste, reichste, längst-lebende Generation der Geschichte - und trotzdem sind wir zunehmend ängstlich.
In der Psychologie ist die Rede vom confirmation bias, wir neigen also dazu, Dinge durch eine uns vermittelte Brille wahrzunehmen. Aengste zu empfinden, die uns einer Gruppe ähnlich denkender und fühlender Personen näher bringt, und uns so gegenseitig in diesen Gefühlen bestärken. Wir Menschen brauchen ein Gut-Böse - Schemata, um uns orientieren zu können. Gruppendynamiken, die längst nicht nur in der populistischen Politik, sondern auch im Marketing genutzt werden. Der Journalist Dan Gardner weist zu Recht auf die Mitschuld der Massenmedien hin, wenn etwa plötzlich die Zahl von 50.000 Pädophilen durchs Netz geistert - und sich herausstellt, dass eine Schweizer NGO die Zahl in die Welt setzte, da wir Menschen uns runde Zahlen sehr viel besser merken können. Wenn die USA im Kampf gegen der Terror geschätzte 100 Milliarden Dollar ausgeben, pro Jahr, aber nie eine nüchterne Kosten - Nutzen - Analyse angestellt wird, dann wird klar: Die Psychologie der Angst ist ein gutes Politiker- Geschäft.
Simpel gesagt: Fear sells. Fear makes money. Das beruhigt doch schon wieder ein bisschen...
Risk - The Science and Politics of Fear; Gardner, Dan; Virgin Books, 2009
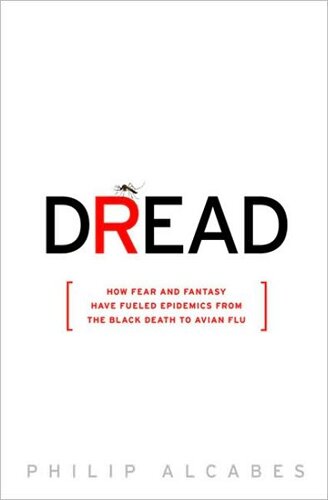
Und wenn die Schweine- Grippe primär einmal ein Marketing-Gag wäre?
Zumindest wird ziemlich stutzig, wer sich Dread des amerikanischen Professors für öffentliches Gesundheitswesen, Philip Alcabes, zu Gemüte führt. Bio-Terrorismus, vor dem uns Politiker und Geheimdienstler immer und immer wieder warnten: Eine tatsächliche Bedrohung hat gar nie bestanden, zeigt Alcabes auf. HIV/Aids: Der Kampf gegen das Virus wurde in den USA auch zu gesellschafts- politischen Zwecken genutzt. Ausgrenzen, eine bestimmte Gruppe - die Anderen - wie die Schwulen dafür verantwortlich machen; wir erinnern uns an den Ausdruck der "Schwulenpest". Und heute sterben sie in Afrika, die Anderen: In Afrika werden bis ins Jahr 2025 bis zu 80 Millionen Menschen an Aids sterben, jährlich sterben heute 2.5 Millionen afrikanische Menschen an Malaria oder Tuberkulose. Ohne dass der Zugang zu längst vorhandenen Medikamenten tatsächlich ermöglicht wird.
Stattdessen schauen wir primär auf die westliche, kaufkräftige Hemisphäre. Alcabes stellt die ketzerische Frage: "We might consider who benefits by forecasting the new threat." Und: "The possible epidemic is rich in potential for managing the public."
Schon geimpft gegen die Schweine- Grippe?
Dread - How Fear and Fantasy Have Fueled Epidemics From The Black Death to Avian Flu; Alcabes, Philip; BBS Puplications, 2009
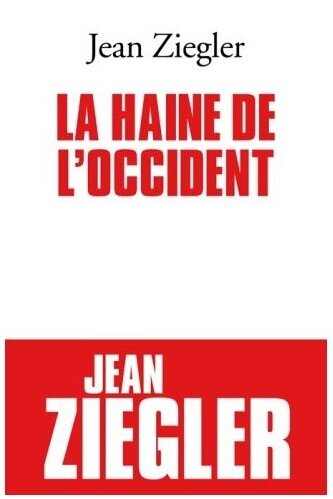
Der streitbare Genfer Soziologe Jean Ziegler muss nicht mehr vorgestellt werden, Freund und Feind haben ihn längst schubladisiert. Und dennoch lohnt sich die Lektüre, provoziert seine Antwort auf die Frage, "warum hassen die uns".
Geschichte, Erinnerungen und anhaltendes Unrecht - ein explosiver Cocktail. Ziegler verweist, teils gar knallig, auf double standards im Nord- Süd-Gefälle, zeigt anhand der Wirtschaftsbeziehungen einiger afrikanischer Länder, spezieller dann zwischen Nigeria, Bolivien, mit "dem Westen" die kränkende "Unterdrückungs-Struktur" auf. Einstige Kolonien erwachen zu eigenständigeren Staaten mit einem neuen Selbstbewusstsein und teils erstaunlichem Wirtschaftswachstum. Aber "nous vivons le temps du retour de la mémoire", warnt Ziegler - Erinnerungen, die uns rasch einmal überrollen können.
Was gemäss Ziegler zu tun wäre, um den Hass auf den Westen zu besiegen: wirkliche, funktionierende Nationalstaaten seien zu schaffen und eine eigenständige Identität der Völker müsse entstehen.
La Haine de L'Occident; Ziegler, Jean; Albin Michel, 2008

Montag, 7. Dezember 2009 um 22:32 >> antworten